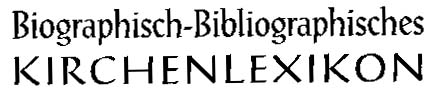Bestellmöglichkeiten des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons
Zur Hauptseite des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons
Abkürzungsverzeichnis des Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikons
Bibliographische Angaben für das Zitieren
NEU: Unser E-News Service
Wir informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten und Änderungen per E-Mail.
Helfen Sie uns, das BBKL aktuell zu halten!
| Verlag Traugott Bautz | | www.bautz.de/bbkl |
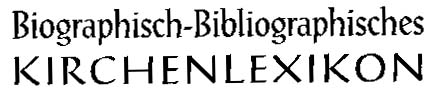 |
| Band XVIII (2001) | Spalten 1313-1322 | Katja Jönsson
Matthias Wolfes
|
SECKENDORFF, Veit Ludwig von, Staatstheoretiker und Historiker, * 20.
Dezember 1626 in Herzogenaurach bei Erlangen, † 18. Dezember 1692 in
Halle / Saale. - Die Kindheit und Jugendzeit von S. verliefen, bedingt
durch die Kriegswirren und den Eintritt des Vaters in schwedische
Dienste, unruhig. Die Erziehung lag in den Händen der Mutter, durch die
S. von früh an auch in die lutherische Frömmigkeit eingeführt wurde.
Nachdem er zunächst Schulen in Mühlhausen, Erfurt und Coburg besucht
hatte, absolvierte er, als Stipendiat des Herzogs Ernst I. von
Sachsen-Gotha (des »Frommen«), das Gymnasium in Gotha. Zu seinen
Lehrern zählte hier der Theologe Salomo Glaß (1593-1656). Ein
anschließend aufgenommenes Studium der Philosophie, Jurisprudenz und
Geschichte führte ihn nach Straßburg. 1645 wurde der neunzehnjährige S.
vom Herzog an den Hof in Gotha berufen, wo er, ungeachtet seines
jugendlichen Alters, mit dem Amt eines Aufsehers über die noch in
Gründung befindliche Herzogliche Bibliothek betraut wurde. Seine
Aufgabe bestand darin, dem Herzog »das Nützliche und Interessanteste«
(ADB 33, 520) aus den neu erworbenen Literaturwerken in sonntäglichen
Mußestunden oder bei Gelegenheit auf Reisen vorzutragen. Daneben oblag
ihm, den Entwurf für eine erste Organisation der Bibliothek
auszuarbeiten. Zu diesem Zweck führte er eine Untergliederung der
Gebiete nach sieben fachlichen Gruppen ein, denen die Bestände
zugeordnet wurden. S. versah nahezu zwei Jahrzehnte lang seine amtliche
Stellung am Gothaischen Hof; in dieser Zeit wurde er der leitende
Beamte der herzoglichen Verwaltung. Zuletzt stand er im Range eines
Wirklichen Geheimrates und Kanzlers. Wegen des Übermaßes an
administrativen Verpflichtungen, die der wachsenden Neigung zur
wissenschaftlich-literarischen Tätigkeit mehr und mehr im Wege standen,
nahm S. 1664 eine Berufung des Herzogs Moritz von Sachsen-Zeitz als
Kanzler und Konsistorialpräsident an. 1669 wurde er zum kursächsischen
Geheimrat und 1676 zum Landschaftsdirektor in Sachsen-Gotha ernannt.
Trotz mancher Mißhelligkeiten blieb er in dieser Stellung bis zum Tode
des Herzogs im Jahre 1681. Anschließend legte er sämtliche Ämter, mit
Ausnahme dessen eines Landschaftsdirektors von Altenburg, nieder und
zog sich auf sein Gut Meuselwitz bei Altenburg zurück. Hier widmete er
sich seinem Werk sowie einer ausgedehnten Korrespondenz, in der er u.a.
mit Leibniz, Pufendorf und Spener verbunden war. Erst 1692 nahm er die
Berufung zum kurbrandenburgischen Geheimrat und Kanzler der
neugegründeten Universität Halle an, doch starb er bereits unmittelbar
nach Ankunft in der Universitätsstadt; die Leichenrede hielt Christian
Thomasius (Abdruck in: Allerhand bißher publicirte Kleine Teutsche
Schrifften, Halle 1701, 547-566). In seiner Persönlichkeit, seiner
umfassenden Wirksamkeit als Staatsmann und Staatstheoretiker sowie als
Beamter und Historiker ist S. eine der hervorragendsten Gestalten des
deutschen Barockzeitalters. - S. trat seit den 1650er Jahren als
produktiver Autor hervor. Vor allem seine staatsrechtlichen Schriften
wurden von den zeitgenössischen Gelehrten intensiv diskutiert. Sein
»Teutscher Fürstenstaat« (Frankfurt am Main 1656) wurde zum
Standardwerk der Verwaltungswissenschaft in den Territorien des
Reiches; es erschien bis 1754 in zwölf Auflagen. Mit dieser Schrift
erwies S. sich als Begründer der wissenschaftlichen Verwaltungslehre
und zugleich als einer der ersten Vertreter der Politischen
Wissenschaft in Deutschland. Aus einer genauen Analyse der politischen
und wirtschaftlichen Verhältnisse im gothaischen Land, die für die
deutschen Verhältnisse insgesamt als repräsentativ gelten konnten,
entwickelt S. einen Aufgabenkatalog für staatliches Handeln, der den
Staat als eingreifenden und lenkenden Staat auffaßt. Über die
klassischen Aufgaben der Friedenssicherung und Gerechtigkeitspflege
hinaus, auf die die liberalen Rechtsstaatstheoretiker des neunzehnten
Jahrhunderts den Staat wieder beschränken wollten, sei Staatszweck »die
Aufrichtung guter Ordnung und Gesetze für die Wohlfahrt und gemeinen
Nutzen des Vaterlandes«. Wohlfahrtspflege wird damit zu einem festen
Bestandteil der staatlichen Verwaltung. Voraussetzung für eine
sachgerechte Wahrnehmung dieser Aufgabe ist nicht zuletzt eine gute
Kenntnis der Verhältnisse im Land, wozu S. die Durchführung
statistischer Erhebungen empfiehlt. Auf der Grundlage einer solchen
Definition des Staatszweckes enthalten die konkreten Einzelausführungen
zahlreiche Vorschläge zur Gestaltung des Verwaltungswesens sowie der
(kameralistischen) Wirtschafts- und Finanzpolitik, auf die auch später
immer wieder zurückgegriffen wurde und die S. den Ruf eines
zukunftsweisenden Staatstheoretikers und Verwaltungswissenschaftlers
sicherten. Träger der staatlichen Politik ist nach S. der Landesherr.
Mit dieser fundamentalen Ausgangsbestimmung gibt S. einer in der
zeitgenössischen staatstheroretischen Diskussion sehr einflußreichen
Position Ausdruck, derzufolge der Ständestaat in seiner
traditionalistischen rechtlichen Organisationsform durch das
absolutistische Staatsmodell abzulösen ist. An den Inhaber der
landesherrlichen Gewalt richteten sich daher auch die Vorschläge, die
im einzelnen unterbreitet werden. Da der Landesherr als Statthalter
Gottes vorgestellt wird und allein ihm gegenüber ein
Verantwortungsverhältnis besteht, können die Verpflichtungen, die der
Landesherr zu übernehmen hat, nach S. keine rechtsverbindlichen Gebote,
sondern lediglich religiös-sittlich fundierte Postulate sein. - Neben
staatsrechtlichen Problemen standen auch theologische Fragestellungen
im Mittelpunkt von S.s Interesse. Vehement trat er als Verfechter des
lutherischen Religionsverständnisses auf (siehe vor allem: Commentarius
historicus et apologeticus de Lutheranismo, sive de reformatione
religionis ductu D. Martini Lutheri, Frankfurt am Main und Leipzig
1688/89). Dabei betonte er insbesondere die Notwendigkeit, Kirche und
Staat vor den radikalreformerischen sozialpolitischen Forderungen der
»Fanatiker« zu schützen. Der »Commentarius historicus et apologeticus
de Lutheranismo«, dessen Ausarbeitung ursprünglich aus der Absicht
hervorgegangen war, eine antiprotestantische Streitschrift des
französischen Jesuiten Louis Maimbourg (1610-1686) (Histoire du
Luthéranisme, Paris 1680) zu widerlegen, versammelt zum Zwecke der
historischen Beweisführung eine derartige Fülle urkundlicher
Materialien, daß man, »so lange man Reformationsgeschichte schreiben
wird, den Namen seines Verfassers immer mit Ehren nennen wird« (Theodor
Kolde, in: RE2
14, 12; vgl. auch Dietrich Blaufuß: Der fränkische Edelmann Veit Ludwig
von Seckendorff (1626-1692) als Reformationshistoriker, in: Jahrbuch
für fränkische Landesforschung 36 (1976), 81-91). S.s Hauptwerk zu
Fragen einer religiös fundierten Sozial- und Staatsethik ist die 1685
in Leipzig erschienene monumentale Abhandlung »Christenstaat«. Das
Werk, das erst nach längerem Zögern und nicht zuletzt auf den Rat
Speners hin vom Autor zu Veröffentlichung freigegeben wurde, ist von
einer scharfen Kritik an den vorfindlichen kirchlichen und
kirchenrechtlichen Gegebenheiten bestimmt. In seinen religiösen
Voraussetzungen geht S. von dem Ideal eines praktischen Christentums
aus, das in mancher Hinsicht Vorstellungen des Pietismus vorwegnimmt,
wenn auch die stark ausgeprägte Erwartung an das staatliche
korrigierende Eingreifen seitens der pietistischen Theologen nicht
geteilt wurde. Von großer wirkungsgeschichtlicher Bedeutung ist die von
S. entfaltete Theorie eines landeshoheitlich ausgeübten
Kirchenregimentes (vgl. Detlef Döring: Untersuchungen zur Entstehung
des »Christenstaates« von Veit Ludwig Seckendorff, in: Europa in der
Frühen Neuzeit. Band 1, Weimar / Köln / Wien 1997, 477-500). Mit ihr
ist in erster Linie die Funktion verbunden, innerkirchliche Mißstände
zu beseitigen. Aus dieser Aufgabenstellung heraus ist sie auf eine
beschränkte zeitliche Reichweite hin angelegt. Der Fürst als Träger der
territorial umgrenzten Obrigkeitsgewalt tritt als Bild »der göttlichen
unermüdeten geschäfftigkeit, gute, gerechtigkeit, weißheit und
vorsichtigkeit« in Erscheinung. Nur unter Einsatz der fürstlichen
Autorität werde es gelingen, den »unrath« zu beseitigen, der sich
allenthalben im Kirchenwesen finde. Sofern der Fürst unmittelbar als
Statthalter Gottes fungiert und allein diesem gegenüber verantwortlich
ist (vgl.: Christenstaat, 266-267), kann es neben ihm keine unabhängige
Macht geben. Auch die Kirche steht unter seiner obrigkeitlichen
Amtsgewalt. In diesem Sinne zeigt S. sich als früher Vertreter des
Territorialsystems. Unter weitgehender Zurückdrängung der Befugnisse
von Theologen und theologischen Gremien wird das Kirchenregiment als
Bestandteil der landeshoheitlichen weltlichen Obrigkeit definiert.
Dabei spannt S. die Kompetenzen des Staates gegenüber der Kirche sehr
weit: In seinen Aufgabenbereich gehört »die Beförderung der wahren
Lehre samt guter Ordnung und disziplin«. Er soll »Macht und Fug
habe[n], die geistlichen hohe und niedere [...] wo und wann es nöthig,
in Sachen den Wohlstand der Kirchen betreffend, zu Rede zusetzen und
die gebrechen nach der regel Göttliches Wortes abzuschaffen, auch durch
heilsame und nützliche Kirchen-Satzungen Christliche zucht und Ordnung
einzuführen« (Ebd., 296-297). Mit dieser Auffassung setzte S. sich der
Kritik zeitgenössischer Vertreter der lutherischen Orthodoxie aus. Denn
von ihnen wurde das Verhältnis von Staat und Kirche keineswegs im Sinne
eines eindeutigen Unterordnungsverhältnisses der Kirche unter den Staat
geregelt. Vielmehr stützen sich hier die Position des Fürsten als
Oberhaupt des Staates, d.h. als Inhaber des ordo politicus und damit
als eine der drei Säulen, auf denen die äußere Gestalt der Kirche ruht,
und seine Stellung innerhalb der Kirche auf unterschiedliche
Begründungszusammenhänge (vgl. Martin Heckel: Staat und Kirche nach den
Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts, München 1968, 157-158). Bei S. hingegen ist die
kirchliche Amtsgewalt des Landesherrn aus einer tendenziell
omnipotenten Stellung heraus fundiert. Im Kampf um die Selbständigkeit
der Kirche, wie er von lutherischen Theologen des späten siebzehnten
und frühen achtzehnten Jahrhunderts ausgetragen wurde, mußte daher der
von S. entwickelten Ansicht widersprochen werden. Hierfür steht etwa
die Kritik Speners am landesherrlichen Kirchenregiment (vgl. Philipp
Jacob Spener: Pia Desideria (Ed. Aland), Berlin 1964, 15; siehe auch
Martin Kruse: Speners Kritik am landesherrlichen Kirchenregiment und
ihre Vorgeschichte, Bielefeld 1971, 28-32, sowie die im
Literaturverzeichnis angeführten Studien von Wolfgang Sommer und
Joachim Whaley). Gegenüber einer von derartigen Vorbehalten bestimmten
Einstellung, der das Interesse an einer nicht allein auf staatliche
Rechtsprinzipien gegründeten rechtlichen Zuordnung der Kirche zum Staat
zugrundeliegt, kann S. als Wegbereiter des Gedankens eines modernen,
souveränen Staates gelten. In der Verhältnisbestimmung von Kirche und
Staat ging es ihm nicht darum, eine theologisch motivierte
Rechtsposition durchzusetzen. Vielmehr war sein zentrales Anliegen auf
das Wohl und Gedeihen des politischen Gemeinwesens selbst gerichtet.
Die damit einhergehenden Beschränkungen kirchlicher
Einwirkungsmöglichkeiten, z.B. des Rechtes von Geistlichen, den
Landesherrn in seinem administrativen Vorgehen, daneben aber auch in
seinem gesamten Leben und Handeln zu kritisieren, hielt S. für
unerläßlich, um den Staatsorganen eine durch religiös begründete
Einsprüche ungehinderte Handlungsfreiheit zu gewährleisten. S. förderte
mit dieser Haltung den Ablösungsprozeß der staatsrechtlichen Theorie
aus christlich-theologischen Vorgaben und Bindungen, wie sie im älteren
Protestantismus und seiner Staatsrechtstheorie durchweg noch bestanden
haben.
Archivalien: Umfangreiche archivalische Bestände, darunter auch
Briefsammlungen zum »Christenstaat«, befinden sich im
»Seckendorff-Archiv« des Altenburg-Thüringischen Hauptstaatsarchivs
Weimar, Außenstelle Altenburg (vgl. die genauen Angaben zum Nachlaß und
zur Geschichte seiner wissenschaftlichen Erschließung und Auswertung
bei Detlef Döring: Untersuchungen zur Entstehung des »Christenstaates«
von Veit Ludwig Seckendorff, in: Europa in der Frühen Neuzeit.
Festschrift für Günter Mühlpfordt. Band 1: Vormoderne. Herausgegeben
von Erich Donnert, Weimar / Köln / Wien 1997, 477-500, besonders:
495-496). - Eine Porträtabbildung befindet sich u.a. bei Gerhard
Pachnicke: Gothaer Bibliothekare. Dreißig Kurzbiographien in
chronologischer Folge. Herausgegeben von der Landesbibliothek Gotha,
Gotha 1958, 5.
Werke (Auswahl): Bericht, worauf die Rechtfertigung, welche
seithero 1562 in Sachen der sämtlichen Grafen zu Schwarzburg contra das
gesamte Chur- und Fürstl. Hauß Sachsen, die Anlegung der Steuern im
Schwarzburgischen betreffend in erster und anderer Instanz geführet
worden, eigentlich und hauptsächlich bestehe und was jedweden Theils
Argumenta und Ablehnungen seye, o.O. 1652; Kurz und wohlgefasster
Bericht von dem auf den 25. Sept. des 1555. Jahres zu Augspurg
geschlossenen Religionsfrieden, als e. Beytrag zu Hrn. Prof. Kappens
Sammlung aufs neue zum Dr.[uck] befördert, u. [...] mit Anm.[erkungen]
versehen von Peter Friedrich Laitenberger, Merseburg 1755; Teutscher
Fürsten-Stat, oder Gründliche und kurtze Beschreibung, welcher gestalt
Fürstenthümer, Graff- und Herrschafften im H. Römischen Reich teutscher
Nation [...] beschaffen zu seyn, regiret [...] zu werden pflegen,
Franckfurth am Main 1656 [Neuausgabe: Teutscher Fürsten Stat, oder:
gründliche und kurtze Beschreibung, welcher Gestalt Fürstenthümer,
Graf- und Herrschaften im h. Roemischen Reich Teutscher Nation, welche
Landes-Fürstliche und hohe Obrigkeitliche Regalia haben, von Rechts und
löblicher Gewonheit wegen beschaffen zu seyen, Regiret zu werden,
Franckfurt 1660; Achte Auflage: Jena 1720]; Kurtzer und deutlicher
Beweiss, Dass weder die Verkündigung zukünfftige Dinge, aus der
Bewegung des Gestirns, ins gemein, Noch insonderheit Die Anmerckung
gewisse Jahre menschlichen Lebens, welche vor andern gefährlich seyn
sollen, und bey den Gelehrten Climacterici genennet werden, Beständigen
Grund habe, sondern solche Unterscheidung an sich selbst nichtig und
vergeblich sey: Dem Hochwerthesten [...] Häupt der Fruchtbringenden
Gesellschafft, Als dessen Fürstliche Durchleuchtigkeit [Wilhelm Herzog
von Sachsen-Weimar] am 11. April 1660 Das Drey und sechtzigste Jahr
Dero Alters angetreten [...] zugeschrieben Von Einem Mitglied ermeldter
Gesellschafft [i.e. Veit Ludwig von Seckendorf], o.O. 1660; Schola
latinitatis. Ad Copiam Verborum et notitiam rerum comparandam, Tam
Etiam Ad Lectionem Autorum Classicorum majori cum successu
instituendam. Usui Paedagogico in Ducatu Gothano accommodata et edita,
Gotha 1662; Justitia Protectionis Saxonicae In Civitate Erfurtensis,
Sive Brevis expositio indubitato Juris: quod Serenissimi Elector Et
Ducis Saxoniae, etc. [...] publicae [...] Anno 1663, Mense Junio, o.O.
o.J. [1663]; [anonym:] Repetita et necessaria defensio protectionis
Saxonicae in civitate Erfurtensi: adversus Scriptum, titulo Assertionis
Moguntinae vulgatum, o.O. [1664]; Additiones Oder Zugaben und
Erleuterungen Zu dem Tractat des Teutschen Fürsten-Stats durch den
Autorem selbst, bey dieser neuen Edition, aus Liebe des gemeinen
Bestens, abgefasset. Anno 1664, Franckfurt am Mayn 1665; Compendium
historiae ecciesiasticae decreto [...] Ernesti Saxon. Jul. Cliviae et
Mont. Ducis [...] in usum Gymnasii Gothani ex sacris literis [...]
libris 2 compositum, Francof.[urti] / Lipsiae 1666 [spätere Fortsetzung
durch andere Autoren]; Christen-Stat. In Drey Bücher abgetheilet; Im
Ersten wird von dem Christenthum an sich selbst [...], Im Andern von
der Verbesserung des Weltlichen, und Im Dritten des Geistlichen Standes
[...] gehandelt; Darbey unterschiedliche merckliche Stellen [...] in
besondern Additionen angehengt zu befinden, Leipzig 1685
[Christen-Stat: In Drey-Bücher abgetheilet, Leipzig 1686, und
zahlreiche weitere Auflagen, u.a.: Christen-Staat: worinn von dem
Christenthum an sich selbst, und dessen Behauptung wider die Atheisten
[...] wie auch von der Verbesserung sowol des Welt- als Geistlichen
Standes, nach dem Zweck des Christenthums gehandelt wird, Leipzig u.a.
1743; ein neuerer Nachdruck liegt nicht vor; Auszüge finden sich in:
Deutsches Staatsdenken im 18. Jahrhundert (Politica. Band 23).
Herausgegeben von Georg Lenz, Neuwied und Berlin 1965]; Leopoldo,
Romanorum Imperatori Augustissimo, Hostium Triumphatori Hungariae Regis
Coronati Filii Josephi Ad hoc & majus fastigium nati & educati,
Patri Optimo honores faustos gratulatur, Et victoriarum perennem cursum
[...] pie auguratur Vitus Ludovicus a Seckendorff Eques [Glückwunsch
zur Krönung Josephs zum König von Ungarn], Francopoli 1688;
Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, sive de
reformatione religionis ductu D. Martini Lutheri: In magna Germaniae
parte, aliisqve regionibus, & speciatim in Saxonia recepta &
stabilita; In quo Ludovici Maimburgii Jesuitae Historia Lutheranismi
Anno MDCLXXX Parisiis Gallice edita, Latine versa exhibetur,
corrigitur, & suppletur, Francofurti et Lipsiae 1688 / 1689
[deutsche Übersetzung siehe unten]; Teutsche Reden: Welche er Von An.
1660. biss 1685. in Fürstl. Sächs. respective Geheimen Raths- und
Cantzlars-Diensten theils zu Gotha, mehrenteils aber zu Zeitz oder als
Landschaffts-Director zu Altenburg [...] abgelegt [...]. Samt einer
Ausführlichen Vorrede von der Art und Nutzbarkeit solcher Reden, o.O.
[Leipzig] 1686 [Zweite Auflage: Teutsche Reden [...]. Jetzo übersehen
und mit Hinzuthuung einer Anno 1686. gehaltenen Trost-Rede bey einer
Fürstl. Leich-Begängniss zum andern mahl aufgelegt, o.O. [Leipzig]
1691]; Bericht und Erinnerung auff eine neulich in Druck Lateinisch und
Teutsch ausgestreuete Schrifft, im Latein Imago Pietismi, zu Teutsch
aber Ebenbild der Pietisterey genannt [...]. Sambt einer Vorrede
Philipp Jacob Speners, darinnen sonderlich die Historie und was in der
Sache bisher vorgegangen, enthalten ist, o.O. 1692; Zweyer
Weltberühmter Leute nöthige und nützliche Erinnerungen, wie sich jungen
Leute auf Universitaeten [...] deren erste ist: Hn. Veit Ludewigs von
Seckendorff, Instruction an seine Herrn Vettern, die andere: Herr D.
Martini Geiers, [...] Väterliche Lehre und Letzter Wille an seinen
liebsten und einzigen Sohne, o.O. [Braunschweig] 1694; Politische und
Moralische Discurse über M. Annaei Lucani dreyhundert auserlesene
lehrreiche sprüche, und dessen heroische gedichte genannt Pharsalia,
auf eine sonderbare neue manier ins deutsche gebracht, und dem
lateinischen auf iedes blatt gegenüber gesetzt; nebst beygefügter
erklärung derer dunckeln und schweren redens-arten, auch nötigem
register, Leipzig (In verlegung Moritz Georg Weidmans Erben und Johann
Ludwig Gleditsch) 1695; Ausführliche Historie des Lutherthums Und der
heilsamen Reformation: welche der theure Martin Luther binnen dreyßig
Jahren glücklich ausgeführet; Aus dem Lateinischen ins Deutsche
übersetzt, in eine gantz neue bequeme Ordnung gebracht, und mit vielen
Anmerkungen nebst einigen neu eingerückten Documenten, vollständiger
Nachricht von denen Wercken des Herrn Lutheri, und einem dreyfachen
sehr nützlichen Register [...] versehen [von] Elias Frick [Vorrede],
Leipzig 1714. - Für die seit 1682 in Leipzig erscheinenden »Acta
eruditorum« verfaßte Seckendorff in großer Zahl Buchbesprechungen.
Lit.: Christian Thomasius: Allerhand bißher publicirte Kleine
Teutsche Schrifften, Halle 1701, 547-566 [Nachdruck: Ausgewählte Werke.
Band 22: Kleine teutsche Schriften. Vorwort von Werner Schneiders;
Personen- und Sachregister von Martin Pott, Hildesheim 1993]; - Philipp
Jacob Spener: Pia Desideria. Herausgegeben von Kurt Aland (Kleine Texte
für Vorlesungen und Übungen. Band 170), Berlin 1964; - Gottfried Daniel
Schreber: Historia vitae ac meritorum in rem tam Viti Ludovici a
Seckendorff publicam, quam litterariam, Lipsiae 1733; - Gustav Marchet:
Studien über die Entwicklung der Verwaltungslehre in Deutschland von
der zweiten Hälfte des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, München
1885 [Nachdruck: Frankfurt am Main 1966]; - Richard Pahner: Veit Ludwig
von Seckendorff und seine Gedanken über Erziehung und Unterricht. Ein
Beitrag zur Geschichte der Pädagogik des 17. Jahrhunderts. Diss. phil.
Leipzig 1892; - Ernst Lotze: Veit Ludwig von Seckendorff und sein
Anteil an der pietistischen Bewegung des XVII. Jahrhunderts. Diss.
theol. Erlangen 1911, Quedlinburg 1911; - Eduard Fueter: Geschichte der
neueren Historiographie (Handbuch der mittelalterlichen und neuern
Geschichte. Abteilung 1), München 1911; - Anneliese Wolf: Die
Historiographie V. L. von Seckendorffs nach seinem »Commentarius
Historicus et Apologeticus de Lutheranismo«. Diss. phil. Leipzig 1925;
- Friedrich Gundolf: Seckendorffs Lacan (Heidelberger Akademie der
Wissenschaften. Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse.
Band 1930/31, 2), Heidelberg 1930; - Horst Krämer: Der deutsche
Kleinstaat des 17. Jahrhunderts im Spiegel von Seckendorffs »Teutschem
Fürstenstaat«, in: Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte
und Altertumskunde. Neue Folge 25 (1922/24); - Walter Schmidt-Ewald:
Veit Ludwig von Seckendorff, o.O. 1926; - Wilhelm Lüdtke: Vitus Ludwig
von Seckendorff als deutscher Staatsmann und Volkserzieher des 17.
Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Akademie zu Erfurt. Neue Folge 54
(1939), 39-137; - Gerhard Pachnicke: Gothaer Bibliothekare. Dreißig
Kurzbiographien in chronologischer Folge. Herausgegeben von der
Landesbibliothek Gotha, Gotha 1958; - Hans-Peter Schneider: Justitia
universalis. Quellenstudien zur Geschichte des »Christlichen
Naturrechts« bei Gottfried Wilhelm Leibniz (Juristische Abhandlungen.
Band VII), Frankfurt am Main 1967; - Martin Honecker: Cura religionis
Magistratus Christiani. Studien zum Kirchenrecht im Luthertum des 17.
Jahrhunderts, insbesondere bei Johann Gerhard, München 1968; - Martin
Heckel: Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen
Deutschlands in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, München 1968; -
Gustav Klemens Schmelzeisen: Der verfassungsrechtliche Grundriß in Veit
Ludwig von Seckendorffs »Teutschem Fürstenstaat«, in: Zeitschrift für
Rechtsgeschichte (GA) 87 (1970), 190-223; - Martin Kruse: Speners
Kritik am landesherrlichen Kirchenregiment und ihre Vorgeschichte
(Arbeiten zur Geschichte des Pietismus. Band 10), Bielefeld 1971,
28-32; - Max Steinmetz: Das Müntzerbild von Martin Luther bis Friedrich
Engels (Leipziger Untersuchungen und Abhandlungen. Reihe B. Band 4),
Berlin 1971; - Dietrich Blaufuß: Der fränkische Edelmann Veit Ludwig
von Seckendorff (1626-1692) als Reformationshistoriker, in: Jahrbuch
für fränkische Landesforschung 36 (1976), 81-91; - Horst Krämer: Der
deutsche Kleinstaat des 17. Jahrhunderts im Spiegel von Seckendorffs
»Teutschem Fürstenstaat«. Mit einer Vorbemerkung zum Neudruck von
Walther Hubatsch (Unveränderter Nachdruck aus: Zeitschrift des Vereins
für Thüringische Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge. Band 25
(1922/1924)) (Libelli. Band 336.), Darmstadt 1974 [Erstausgabe siehe
oben]; - Hans Maier: Die ältere deutsche Staats- und Verwaltungslehre
(Polizeiwissenschaft). Zweite, neubearbeitete und ergänzte Auflage,
München 1980; - Gerd Kleinheyer: Veit Ludwig von Seckendorff
(1626-1692), in: Gerd Kleinheyer / Jan Schröder: Deutsche Juristen aus
fünf Jahrhunderten. Eine biographische Einfürhung in die Geschichte der
Rechtswissenschaft. Zweite, neubearbeitete und erweiterte Auflage,
Heidelberg 1983, 241-243; - Michael Stolleis: Veit Ludwig von
Seckendorff, in: Ders. (Hg.): Staatsdenker im 17. Und 18. Jahrhundert.
Zweite Auflage, Frankfurt am Main 1987, 148-171; - Gerhard Rechter: Die
Seckendorff. Quellen und Studien zur Genealogie und Besitzgeschichte.
Herausgegeben von der Gesellschaft für Fränkische Geschichte
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für Fränkische Geschichte. Band
9), Neustadt a.d. Aisch 1987; - Wolfgang Sommer: Gottesfurcht und
Fürstenherrschaft. Studien zum Obrigkeitsverständnis Johann Arndts und
lutherischer Hofprediger zur Zeit der altprotestantischen Orthodoxie,
Göttingen 1988; - Joachim Whaley: Obedient servants? Lutheran attitudes
to authority and society in the first half of the seventeenth century:
The case of J. B. Schupp, in: The Historical Journal 35 (1992), 27-42;
- Detlef Döring: Säkularisierung und Moraltheologie bei Samuel von
Pufendorf, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 90 (1993), 156-174;
- Detlef Döring: Untersuchungen zur Entstehung des »Christenstaates«
von Veit Ludwig Seckendorff, in: Europa in der Frühen Neuzeit.
Festschrift für Günter Mühlpfordt. Band 1: Vormoderne. Herausgegeben
von Erich Donnert, Weimar / Köln / Wien 1997, 477-500; - Jens Wilhelm
Stahlschmidt: Policey und Fürstenstaat. Die gothaische
Policeygesetzgebung unter Herzog Ernst dem Frommen im Spiegel der
verfassungsrechtlichen und policeywissenschaftlichen Anschauungen Veit
Ludwig von Seckendorffs. Diss. phil. Bochum 1999; - RE2 14 (1884), 12-16 (Theodor Kolde); - ADB 33 (1891), 519-521 (Theodor Kolde); - RGG1 V, 517-518; - RGG2 V, 364; - RGG3 IV, 1629-1630; - DBE 9 (1998), 253; - DBA I, 1167, 390-454; - DBA II 1209, 193-208.
Katja Jönsson
Matthias Wolfes
Quellen- und Literaturergänzungen
Vgl.: Dietrich Blaufuß:
[Artikel] Seckendorff, Veit Ludwig von (1626-1692), in: Theologische
Realenzyklopädie [TRE] Bd. 30, Berlin 1999, 719-727.
Archivalien: Staatsarchiv Darmstadt; - Staatsarchiv Dresden; -
Staatsarchiv Gotha; - Forschungs- und Landesbibliothek Gotha; - Archiv
Franckesche Stiftungen Halle (Saale); - Staats- u. Univ.-Bibl. Hamburg;
- Landesbibl. Karlsruhe; - Gräfl. Solms-Laubachisches Archiv Laubach. -
Einzelheiten u. weiteres s. TRE 30. 1999; 724, Z.24-41.
Porträtabbildungen/Gemälde in Halle (Saale), Zeitz, Obernzenn und Unternzenn. - Einzelheiten s. TRE 30. 1999; 724,42-45.
Werke (Auswahl): Teutscher Fürsten stat, 3. Aufl. Frankfurt a.M.
1665, [Faks.-Druck Glashütten/Nendeln 1676]; 10. Aufl. Jena 1737, hg.
von A. Simson v. Biechling [Faks.-Druck Aalen 1972]; Jena 1754;
Frankfurt a.M./Leipzig 1762-63. - Ius publicum Romano-Germanicum, das
ist Beschreibung des H. Röm. Reichs Teutscher Nation, Fankfurt
a.M./Leipzig 1686, ²1687. - Commentarius ... de Lutheranismo I 1688.4°,
Supplementum 1689.12°; I-III 1692 und wieder 1694.2°; dtsch. Bearb. von
Elias Frick, Ulm 1714; I-III niederl., Delft 1728-30; Bearb.,
m.e.Anhang 1546-1555, von Christian Friedrich Junius, Benjamin Lindner,
Gottlob Er(d)mann Gründler, Teile 1-4, Frankfurt a.M./Leipzig 1755,
unveränd. abgedruckt von A. Schlitt, Baltimore 1865-68; verb. Auszug C.
F. Junius', mit Anmerkungen von Joh. Fch. Roos, Tübingen 1782, französ.
Übers., 5 Bde., Basel 1784-85 u. Berlin o.J., 2., ganz umgearb. Aufl.
von Fch. Magnus Roos, Tübingen 1788,- Einzelheiten und weiteres s. TRE
30. 1999, 725, v.a. Z.19-38.
Lit. - Quellen, -verzeichnisse, Bibliographien/Literaturübersichten:
Otto Clemen: Zei unveröffentlichte [!] Briefe Ph. J. Speners [an V. L.
v. Seckendorff], in: Monatshefte der Comeniusges. 12 (1903), 39-44; -
Ders.: Zur Reformationsgeschichte von Bopfingen, in: Blätter für Würrt.
Kirchengesch. 33 (1929), 159-163; - Gottfr. Wilhelm Leibniz: Sämtl.
Schriften und Briefe. Akad.-Ausg. I/3-8 und II/1,Darmstadt u.a. 1923- ;
- Ernst Walter Zeeden: Martin Luther und die Reformation im Urteil des
deutschen Luthertums, Bd. 2, Freiburg i.Br. 1954, 151-169 (lat. mit dt.
Übers.); - Dietrich Blaufuß: Veit Ludwig v. Seckendorfs Commentarius de
Lutheranismo und der Beitrag des Augsburger Seniors Gottlieb Spizel,
in: Zeitschr. für bayerische Kirchengeschichte 39, 1970,
138-164.269-276 (m.Abb.); - Gerhard Pfeiffer: Fränkische Bibliographie,
III/1, 1974 (Schrifttum bis 1945); - Nilüfer Krüger: Supellex
Epistolica Uffenbachii et Wolfiorum, Hamburg 1978; - Bibliographie zur
deutschen Literaturgeschichte des Barockzeitalters, von Hans Pyritz,
forgef. von Ilse Pyritz, 2 Teile, Bern 1985; - Philipp Jakob Spener:
Schriften, hg. von Erich Beyreuther, Bde. 14 [1702] und 15 [1711]
(eingel. von Dietrich Blaufuß), Hildesheim 1999 und 1987; - Peter
Mortzfeld: Katalog der graphichen Porträts in der
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, Bd. 22, München 1993; - Georg
Rechter: Die Archive der Grafen und Freiherrn von Seckendorff [...] in
Obernzenn, Sugenheim, Trautskirchen und Unternzenn, Bde. 1-3, Neustadt
a.d. Aisch 1993.
Lit.: Wilhelm Ernst Tentzel/ErnstSalomo Cyprian: Histor. Bericht
vom Anfang [...] der Reformation [...], 1.-2. Teil, Gotha 1717, Leipzig
1718; - Johann Peter Ludewig: Öconomische Anmerckungen über
Seckendorffs Fürsten-Staat [...], Leipzig 1753; - Lewis William Spitz
[sen.]: A Critical Evaluation of V. L. v. Seckendorf as a Church
Historian, Diss. phil. Univ. of Chicago 1943, masch. (vorh. UB Tübingen
R 1078p); - Ernst Walter Zeeden: Der ökumenische Gedanke in V. L. v.
Seckendorfs Historia Lutheranismi, [1950, wieder in:] Ders.:
Konfessionsbildung, Stuttgart 1985, 9-24; - Ders.: Martin Luther und
die Reformation im Urteil des deutschen Luthertums, Bd. 1, Freiburg
i.Br. 1950, 113-128 (engl.: Westminster, Md. 1954); - Klaus Garber: Zur
Statuskonkurrenz von Adel und gelehrtem Bürgertum im theoretischen
Schrifttum des 17.Jh., in: Daphnis 11 (1982), 115-143; - Klaus Wetzel:
Theologische Kirchengeschichtsschreibung im deutschen Protestantismus
1660-1760, Gießen 1983; - Gerhard Rechter: Veit Ludwig v.
Seckendorff-Gutend, in: Fränkische Lebensbilder, Bd. 12, Würzburg 1986,
104-122 (Abb., Übersichstafel); - Georg Braungart: Seckendorff und die
Funktion der Rede im Fürstenstaat, in: Ders.: Hofberedsamkeit, Tübingen
1988, 255-288; - Thomas Baumann: Zwischen Weltveränderung und
Weltflucht [...], Lahr-Dinglingen 1991; - Dietrich Blaufuß: Zum Bild
der Reformation im Pietismus. Ph. J. Spener und V. L. v. Seckendorf,
in: Texte und Studien der Arbeitsstelle für kulturwiss. Forschungen 1,
Engi/CH 1996, 104-127; - Ders.: PastorAulicus conscientiosius. Ph. J.
Spener und V.L. v. Seckendorff im Gespräch über "Gottesfurcht und
Fürstenherrschaft", in: Festschrift Hartmut Laufhütte, hg. von
Hans-Peter Ecker, Passau 1997, 201-214; - RüdigerMack:
Christl.-toleranter Absolutismus.V. L. v. Seckendoff u.s. Schüler Graf
Fch. Ernst zu Solms-Laubach, in: Mitt. des Oberhess.Geschichtsvereins
NF 82 (1997), 3-135; - Edith Schoeneck: Der Bildersaal im Blauen Schloß
zu Obernzenn, Ansbach 1997.
Unveröffentlichte Arbeiten: Ulrich Heß: Forschungen zur
Verfassungs- und Verwaltunsgeschichte des Herzogtums
Sachsen-Coburg-Meiningen 1680-1829, 4 Bde., o.O. 1954 (masch.); - Hans
Mempel: Friedrich Ernst Reichsgraf zu Solms-Laubach. Abriß seines
Lebens, o.O. o.J. [ca.1970] (Jahresarbeit am Laubach-Colleg; masch.,
vorh. HauptB Franckesche Stiftungen Halle/Saale); - Hans-Jörg Ruge: Vom
Bibliothekar zum Geheimen Rat. Aspekte der beruflichen Laufbahn V. L.
v. Seckendorffs in den Jahren seiner Anstellung im sachsen-gothaischen
Staatsdienst (1646-1664), Berlin/Leipzig/Gotha 1992 (masch., vorh. UB
Erlangen). Einzelheiten und weiteres siehe TRE 39. 1999, 724-727.
Dietrich Blaufuß
Letzte Änderung: 27.02.2001